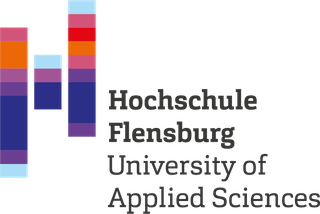Im Gespräch erklärt Prof. Dr. Britta Blotenberg, Studiengangsleiterin, wie ein akademischer Abschluss Pflegekräfte international wettbewerbsfähig macht, neue Kompetenzen für komplexe Versorgungssituationen vermittelt und Digitalisierung sowie Ethik fest im Curriculum verankert. Sie zeigt auf, wie Theorie und Praxis eng verzahnt werden und welche spannenden Karriereperspektiven sich für Absolvent*innen eröffnen.

Warum braucht es heute ein Pflegestudium – was leistet ein akademischer Abschluss, was die klassische Ausbildung nicht abdeckt?
Die Antwort liegt auf der Hand: Ein Pflegestudium ermöglicht eine internationale Anschlussfähigkeit. In nahezu allen europäischen Ländern ist ein Studium in der Pflege Standard – wer also grenzüberschreitend arbeiten oder sich weiterqualifizieren möchte, benötigt einen international anerkannten Abschluss.
Darüber hinaus geht es um ein neues berufliches Profil: Akademisch qualifizierte Pflegekräfte bringen zusätzliche Kompetenzen mit, die eine klassische dreijährige Ausbildung allein nicht abdeckt. Sie sind in der Lage, hochkomplexe Pflegesituationen differenzierter zu analysieren, pflegewissenschaftliche Literatur zu nutzen und die dort gewonnenen Erkenntnisse gezielt in die Praxis zu überführen. Damit leisten sie nicht nur fachlich, sondern auch auf Haltungsebene einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung der Pflege.
Welche Schwerpunkte setzt der Studiengang?
Wir bieten zwei Vertiefungsrichtungen an: „Pflege alter Menschen“ und „Digitalisierung in der Pflege“. Beides sind zentrale Zukunftsthemen. Die demografische Entwicklung zeigt, dass unsere Gesellschaft älter wird – und anders altert als früher. Chronische Erkrankungen und Multimorbidität nehmen zu, was neue Anforderungen an pflegerische Versorgung und Kommunikation mit den Betroffenen stellt. Viele dieser Menschen werden zu Expert*innen in eigener Sache, weshalb wir als Pflegefachpersonen neue Wege im Umgang und in der Zusammenarbeit finden müssen.
Gleichzeitig verändert die Digitalisierung unsere gesamte Gesellschaft – und damit auch die Pflege. Wir müssen uns fragen: Was kann uns Digitalisierung bringen? Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz in der Pflegepraxis? Es braucht Pflegekräfte, die digitale Entwicklungen verstehen, mitgestalten und sinnvoll in den Berufsalltag integrieren können – als Anwender*innen, aber auch als Multiplikator*innen in ihren Teams in den unterschiedlichen Versorgungsbereichen.
Hat die akademisch qualifizierte Pflegefachperson damit auch eine Art Brückenfunktion?
Absolut. Eine akademisch ausgebildete Pflegefachperson bringt pflegerische Fachlichkeit und Wissen über digitale Systeme zusammen – sie kennt den Berufsalltag, spricht die Sprache der Pflege und kann so viel besser beurteilen, welche digitalen Tools tatsächlich Sinn machen. Anders als beispielsweise ein/e IT-Expertin/e ohne Felderfahrung kann sie zwischen technischer Innovation und pflegerischem Bedarf vermitteln und gezielt Einfluss nehmen.
Wie ist das Studium aufgebaut?
Als Hochschule für angewandte Wissenschaften ist uns die enge Verzahnung von Theorie und Praxis besonders wichtig. Deshalb arbeiten wir mit einer Vielzahl an Praxispartnern zusammen – von Akutkrankenhäusern über ambulante Pflegedienste bis hin zur stationären Langzeitpflege. Aktuell kooperieren wir mit zehn Einrichtungen, bei denen sich Studierende für ihre Praxiseinsätze bewerben können.
Das Studium ist in Theorie- und Praxisphasen gegliedert. Lehrveranstaltungen beinhalten neben der Wissensvermittlung auch praktische Übungen – insbesondere im sogenannten Skills Lab. Dort schaffen wir realitätsnahe Übungsräume, die Settings aus der stationären Versorgung, aber auch aus der ambulanten und Langzeitpflege simulieren. Die Studierenden können in einem geschützten Rahmen pflegerische Maßnahmen erproben, Sicherheit gewinnen und Ängste abbauen, bevor sie diese in der echten Versorgungssituation anwenden.
Welche Rolle spielen Themen wie Evidenzbasierung und Ethik in der Pflegeausbildung?
Eine große. Evidenzbasiertes Arbeiten heißt, sich an der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnis zu orientieren und Routinen zu hinterfragen. Ein Beispiel: Früher wurde Dekubitus mit Föhn und Eis behandelt, bis wissenschaftlich belegt wurde, dass diese Methoden sogar schädlich sind. Solche Entwicklungen zu erkennen, zu reflektieren und zu ändern, erfordert ein fundiertes wissenschaftliches Verständnis.
Ethik ist ebenfalls zentral – insbesondere im Zusammenhang mit Digitalisierung und Datenschutz. Wer Daten erhebt, muss sich fragen: Wozu dienen sie? Was ist vertretbar? Muss beispielsweise ein Sturzvideo die betroffene Person erkennbar zeigen – oder reicht eine anonymisierte Information? In Deutschland gelten strenge gesetzliche Vorgaben, und unsere Studierenden sollen befähigt werden, diese kritisch zu reflektieren und verantwortungsvoll umzusetzen.
Können auch beruflich Qualifizierte ins Studium einsteigen?
Ja, Pflegefachpersonen mit abgeschlossener dreijähriger Ausbildung können ab dem Wintersemester 26/27 direkt ins dritte Fachsemester einsteigen. Sie bringen bereits eine wertvolle pflegerische Expertise mit, die sie im Studium durch akademisches Wissen und erweiterte heilkundliche Kompetenzen ergänzen.
Ich hoffe, dass diese Gruppe besonders interessiert ist, bestehende Strukturen zu hinterfragen und aktiv an Veränderungen mitzuwirken. Sie kennen die Praxis, bringen reale Fragestellungen mit und können Studieninhalte direkt mit der Versorgungssituation verknüpfen. Das bereichert den Diskurs ungemein, sowohl für die Lehrenden als auch für die Mitstudierenden.
Welche Karrierewege stehen den Absolvent*innen offen?
Zum einen eröffnet der Studienabschluss neue berufliche Handlungsfelder innerhalb der Versorgung. Wir bilden in erster Linie für die direkte pflegerische Praxis aus – aber mit einem erweiterten Kompetenzprofil. Akademisierte Pflegefachpersonen können eigenständiger arbeiten, insbesondere bei bestimmten erweiterten heilkundlichen Tätigkeiten im Umgang mit Demenz, chronischen Wunden oder Diabetes.
Zum anderen verändert sich auch der Austausch mit anderen Berufsgruppen – beispielsweise mit Ärzt*innen. Durch die interdisziplinäre Lehre, etwa durch Humanmediziner*innen in unserem Studiengang, stärken wir das medizinische Wissen und damit die kommunikative und fachliche Sicherheit im Berufsalltag.
Und was bedeutet das für das berufliche Selbstverständnis?
Ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt für die Professionalisierung der Pflege insgesamt. Die Akademisierung verleiht der Pflege mehr Eigenständigkeit, fachliche Tiefe und gesellschaftliche Sichtbarkeit. Bisher waren erweiterte heilkundliche Tätigkeiten ein durch die Ärzt*innen zu delegierendes Handlungsfeld. Zukünftig können sie eigenverantwortlich und evidenzbasiert ausgeführt werden. Das stärkt nicht nur das Selbstverständnis, sondern auch das Standing der Pflege im interdisziplinären Zusammenspiel.
Letztlich geht es darum, die Pflege zukunftsfest zu machen – für die Patient*innen, für das Gesundheitssystem und für die Profession selbst.