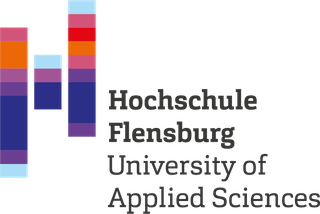Vor Kurzem wurde die Fähre AutoGnom im Rahmen der Eröffnung des neuen Wasserplatzes am Brauereiweg erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Zahlreiche Gäste konnten einen ersten Blick auf das ungewöhnliche Forschungsschiff werfen, das bald die Förde überqueren soll.

Mit der Elektrofähre AutoGnom entwickelt die Hochschule Flensburg derzeit ein zukunftsweisendes Mobilitäts- und Forschungsprojekt, das maritime E-Mobilität, Digitalisierung und intelligente Verkehrsführung auf dem Wasser miteinander verbindet. Die kleine Fähre soll ab 2026 zunächst testweise zwischen dem West- und dem Ostufer der Flensburger Förde pendeln – in den ersten Jahren noch mit Personal an Bord, perspektivisch aber vollautonom.
Ein Projekt mit vielen Zielen
Das Vorhaben verfolgt mehrere Ziele gleichzeitig: Die AutoGnom soll künftig nicht nur Personen und Fahrräder befördern, sondern auch ein realitätsnahes Testfeld für moderne Technologien im maritimen Bereich bieten. Im Fokus stehen vor allem elektrische Antriebssysteme, autonome Navigationslösungen und automatisierte Unterstützungsfunktionen wie An- und Ablegen, Laden oder Notfallreaktionen.
„Mit der AutoGnom schaffen wir eine Plattform, die unabhängig von Einschränkungen bestehender Systeme funktioniert – und auf der wir technologische, betriebliche und regulatorische Fragestellungen gleichermaßen untersuchen können“, sagt Projektleiter Prof. Dr.-Ing. Michael Thiemke vom Maritimen Zentrum der Hochschule Flensburg.
Gefördert wird das Projekt mit 300.000 Euro aus dem Exzellenz- und Strukturbudget des Landes Schleswig-Holstein sowie mit weiteren 300.000 € durch die Smarte Grenzregion. Gebaut wurde die Fähre von der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), mit der die Hochschule seit Jahren erfolgreich kooperiert.
Technische Daten und Bauverlauf
Die AutoGnom ist 10,5 Meter lang, 4,5 Meter breit und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von rund 20 Tonnen. Sie kann bis zu 12 Personen sowie drei Fahrräder transportieren. Der Brennschnitt für den Schiffskörper markierte den Start der Bauphase. Bereits im Dezember 2023 erfolgte der Stapellauf unter der Baunummer 803 – ein bedeutender Meilenstein.
Die Fertigung der Fähre erfolgte bei der FSG in enger Zusammenarbeit mit dem Projektteam der Hochschule. Ein Großteil der Fertigung erfolgte durch die Auszubildenden der FSG, angeleitet durch ihre Ausbilder und mit einer professionellen Rumpfabnahme durch die Klassifikationsgesellschaft RINA.
Die Werft brachte dabei ihr technisches Know-how in den Bereichen Schiff- und Stahlbau mit ein – ein echter Glücksfall für das Projekt, wie Thiemke betont: „Die Kolleginnen und Kollegen bei der FSG haben den Bau mit viel Umsicht und hoher Motivation vorangetrieben.“
Einsatzgebiet und Perspektive
Ab 2026 soll die Fähre in den Erprobungsbetrieb auf der Flensburger Förde gehen. Vorgesehen sind Anleger am Galwikpark (Westufer) sowie nahe des Piratennests (Ostufer). Die konkrete Streckenführung befindet sich aktuell noch in Abstimmung mit Stadt und Genehmigungsbehörden.
Geplant ist, die Fähre im Rahmen einer kommerziellen Kooperation betreiben zu lassen. Damit lassen sich sowohl die laufenden Betriebs- und Wartungskosten decken als auch wertvolle Einsatzdaten sammeln – etwa zur Effizienz des elektrischen Antriebs, zur Systemstabilität oder zur Interaktion mit Fahrgästen.
Der Fährbetrieb wird in den ersten Jahren von ausgebildetem Personal begleitet, das die Sicherheit der Navigation und an Bord und an den Anlegern gewährleistet. Langfristig aber ist das Ziel, den Betrieb schrittweise vollständig autonom und ohne menschliches Eingreifen zu ermöglichen.
Forschungsschwerpunkt: Mehr als nur Navigation
Im Gegensatz zu vielen anderen Projekten, die sich auf die autonome Navigation allein konzentrieren, untersucht die Autognom auch alle flankierenden Systeme, die für einen genehmigungsfähigen, unbemannten Fährbetrieb notwendig sind. Dazu gehören unter anderem:
- Automatisierte Ladeinfrastruktur für den vollelektrischen Betrieb
- Autonomes An- und Ablegen unter wechselnden Umweltbedingungen
- Selbsttätige Auslösung von Rettungsmitteln
- Reaktion auf Notfallszenarien (Risk Management, FMEA)
- Entwicklung sicherheitsrelevanter Backup-Systeme
- Integration mit Landinfrastruktur (Smart Docking)
Ein besonderer Fokus liegt auf dem Zusammenspiel aller Teilsysteme, auch im Falle von Ausfällen oder externen Störungen. Damit leistet das Projekt wichtige Vorarbeit für spätere Zulassungsverfahren und genehmigungsfähige Konzepte in der autonomen Schifffahrt.
Studierende gestalten mit
Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die Einbindung von Studierenden. Sie unterstützen aktiv die Entwicklung, erproben eigene Lösungsansätze und erhalten dabei tiefe Einblicke in aktuelle Forschungsthemen. Perspektivisch soll die Plattform auch für schulische Projekte oder Jugend-Forscht-Initiativen geöffnet werden. „Unsere Studierenden arbeiten hier an realen Problemstellungen mit direktem Praxisbezug – eine wertvolle Erfahrung und ein echter Mehrwert für Lehre und Forschung“, so Thiemke.
Zukunft mit Vorbildcharakter
Langfristig soll das Projekt AutoGnom als Blaupause für weitere Anwendungen dienen: für kleine Städte mit begrenztem Fährbedarf, für Tourismusbetriebe mit saisonalen Schwankungen oder auch für die intelligente Ergänzung bestehender Verkehrsangebote auf dem Wasser.
Ein Beispiel: In der Nebensaison könnte die Fähre tagsüber autonom bereitstehen und bei Bedarf, etwa bei drei wartenden Fahrrädern, automatisch in Betrieb gehen. Damit entstehen neue, flexible Mobilitätsangebote ohne dauerhaft gebundenes Personal – wirtschaftlich, nachhaltig und technisch innovativ.