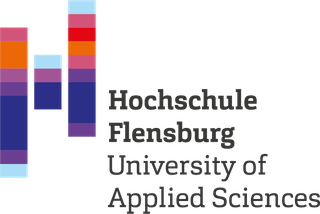Computer- und Videospiele stellen heute einen elementaren Bestandteil (jugendlicher) Medienwelten dar. Mit der wachsenden Bedeutung schließen sich Fragen nach möglichen (pädagogischen) Potentialen von zum Beispiel Computer- und Videospielen an.
Beschreibung
Computer- und Videospiele stellen heute einen elementaren Bestandteil (jugendlicher) Medienwelten dar (vgl. mpfs 2014). Mit der wachsenden Bedeutung schließen sich Fragen nach möglichen (pädagogischen) Potentialen von zum Beispiel Computer- und Videospielen an. Hierzu gibt es in der wissenschaftlichen Community breite Absätze sowohl in der Grundlagen- als auch Bildungsforschung. Lehrende, insbesondere Hochschullehrende, die im Lehramtsstudium tätig sind, können hierbei perspektivisch von neuen und innovativen Ansätzen für eigene Lehr- und Forschungsperspektiven profitieren.
Seminarinhalte
Der Workshop ist auf insgesamt 1,5 Tage ausgelegt.
In einer ersten Phase werden mit den Teilnehmenden eigene Erfahrungen und Perspektiven über Computer- und Videospiele diskutiert. Im Vordergrund steht hier, an Alltagspraxen und –vorstellungen zum Gegenstand des Workshops anzuknüpfen. Eine Einführung zu wissenschaftlichen Interessenfeldern von Computer- und Videospielen werden diese erste Phase abrunden.
In der zweiten Phase werden die Teilnehmenden des Workshops vorausgewählte, populäre Computer- oder Videospiele spielen. Ziel dabei ist es, dass die Teilnehmenden, neben dem eigentlichen Spielerleben, mögliche pädagogisch-relevante Aspekte von Computer- und Videospielen für Lehr-Lern-Szenarios extrahieren.
In einer dritten Phase wird die erlangte Spielerfahrung vor dem Hintergrund ethischer und pädagogisch-theoretischer Aspekte reflektiert. Im Anschluss gilt es, in Gruppen gemeinsam mögliche Einsatzszenarien der gespielten Spiele (oder anderer) anhand konkreter Unterrichts- bzw. Lehrplanungen zu entwickeln. Dabei geht es um ein kritisches Abwägen von Vor- und Nachteilen eines etwaigen Einsatzes von Computer- oder Videospielen in Hinblick auf professionell-pädagogische Settings. Im Anschluss sollen die Ergebnisse im Plenum diskutiert werden.
Anschließend wird in der vierten Phase das Konzept des sogenannten Digital Game-Based Learning (Prensky 2007) vorgestellt und anhand didaktischer Beispiele (u.a. Squire 2011) verdeutlicht. Eine Diskussion über den Einsatz von Computer- und Videospielen in pädagogischen Settings wird den Workshop abschließen. Dabei werden sowohl die Perspektiven aller Teilnehmenden als auch die während des Workshops erlangten Erfahrungen und Kenntnisse mit einbezogen. Der Workshop ist ergebnisoffen.
Lehrgangsziele
Die Teilnehmenden
- erlangen Kenntnisse über die Relevanz von Computer- und Videospielen als Lebens- und Erfahrungsräume von Jugendlichen,
- wissen um die ökonomischen Rahmenbedingungen als auch wichtiger Meilensteine der historischen Genese von Computer- und Videospielen,
- erhalten Einblick in aktuelle wissenschaftliche Diskussionen zu Computer- und Videospielen,
- erarbeiten, unter Hinzunahme eigener didaktischer Expertisen als auch Perspektiven aus der Computerspielforschung, erste Annäherungen an eigene Lehr-Lern-Konzepte.
Literatur
Literatur im Vorfeld:
- Ganguin, S. (2012). Gaming Seriously? A Quantitative Study of Students’ Conception of "Playing". Kaminski, W. & Lorber, M. (Hrsg.). Gamebased Learning. Clash of Realities 2012. S. 13-31. München: kopaed Verlag.
Weiterführende Literatur:
- Biermann, R. (2012). Digitale Spiele und die Akzeptanz im schulischen Kontext. In Kaminski, W. & Lorber, M. (Hrsg.). Gamebased Learning. Clash of Realities 2012. S. 71-86. München: kopaed Verlag.
- Boelmann, Jan M. (2015). Literarisches Verstehen mit narrative Computerspielen. Eine empirische Studie zu den Potentialen der Vermittlung von literarischer Bildung und literarischer Kompetenz mit einem schüleraffinen Medium. München: kopaed Verlag.
- Fromme, J., Biermann, R. & Unger, A. (2010). "Serious Games" oder "taking games seriously"? In Hugger, K.-U. & Walber, M. (Hrsg.). Digitale Lernwelten. Konzepte, Beispiele und Perspektiven. S. 39-57. Wiesbaden: VS-Verlag.
- Heinze, C. (2012). Mittelalter Computer Spiele. Zur Darstellung und Modellierung von Geschichten im populären Computerspiel: Bielefeld: transcript.
- Prensky, M. (2007). Digital Game-Based Learning. St. Paul: Paragon House.
- Sicart, M. (2009): The Ethics of Computer Games. MIT Press: Cambridge, P. 107-151.
- Squire, K., Jenkins, H., 2011. Video games and learning. Teaching and participatory culture in the digital age. New York: Teachers College Press.
Zielgruppe:
Alle in der Lehre Beschäftigten
Referierende:
Robert Aust, Michael Nitsche
Dauer:
2 Tage
Zeit:
03.06.2016, 09:00 bis 18:00 Uhr und
04.06.2016, 09:00 bis 13:00 Uhr
Ort:
Erweiterungsbau - Camelot (EB 060)
Anmeldung:
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Namen, Fachbereich und Ihrer Statusgruppe bis zum 19.05.2016 an unter: hochschuldidaktik(fh)fh-flensburg.de.
Bei Abwesenheit ohne Krankschreibung oder rechtzeitiger Abmeldung (zwei Tage vorher) müssen für alle Statusgruppen 50 € erhoben werden.