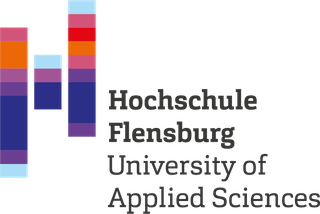Das DSP Labor an der Hochschule Flensburg bietet Studierenden die Möglichkeit, sich mit der Programmierung und Anwendung von digitalen Signalprozessoren (DSP) zu beschäftigen. Es dient zur Vertiefung des Vorlesungsstoffes im Bereich der digitalen Steuerung und Regelung, insbesondere mit dem TMS320F28027 DSP von Texas Instruments. Die Studierenden erlernen die Verwendung von DSPs für die Realisierung von Steuerungs- und Regelungsaufgaben, wie z.B. die Drehzahlregelung von Dieselmotoren. Mithilfe von Code Composer Studio wird die Programmierung in C durchgeführt, einschließlich Debugging und Testen auf einem Entwicklungsboard. Die Experimente decken sowohl digitale Ein-/Ausgaben als auch analoge Signalerfassung, Ausgabe und Regelung ab.
Laborgeräte und sonstige Ausstattung
- C2000 Piccolo LaunchPad Entwicklungsboard /DSP-Modell: TMS320F28027
- Experimentiermodell (Dieselmotor-Simulation)
- Stromversorgungseinheit
- LC-Display/GPIO-Anbindung über DSP
- Oszilloskop/ 100 MHz/2 Eingangskanäle 2
- Analoge Ein-/Ausgänge (ADC und PWM)/ 12-Bit, bis zu 16 Kanäle
- Funktionsgenerator/1 Hz bis 10 MHz/Sinus, Rechteck, Dreieck
- Potentiometer/Simulation von Laständerungen für den Motor
- PWM-Motorsteuerung (LMD18200-Brücke)/ Steuerung von Motoren mit PWM-Signalen
- PC mit Code Composer Studio/Code Composer Studio (TI)
Einsatzmöglichkeiten
Digitale Ein- und Ausgaben
Erlernen des Umgangs mit digitalen Ein- und Ausgängen über GPIO-Pins am DSP, wie das Erfassen und Schalten von Signalen mit Schaltern und Ausgängen
Analoge Signalverarbeitung
Erfassen von analogen Signalen wie Motordrehzahl und Stellgliedposition über den A/D-Wandler des DSP. Diese Signale werden weiterverarbeitet und in Variablen abgelegt, um eine spätere Regelung zu ermöglichen
Werteausgabe auf LC-Display
Ausgabe von Messwerten und Texten auf ein LCD (4x16 Zeichen), um Echtzeitinformationen über den Zustand des Systems wie Drehzahl und Sollwert zu überwachen
Pulsweitenmodulation (PWM)
Erzeugung eines PWM-Signals zur Steuerung des Stellantriebsmotors. Dies ermöglicht eine präzise Regelung der Motordrehzahl und der Position über den DSP
Sprungantwort der Stelleinrichtung
Untersuchung der Sprungantwort des Stellantriebes. Diese wird mittels Oszilloskop aufgezeichnet, um das dynamische Verhalten des Antriebssystems zu analysieren und für die Positionierungsregelung zu optimieren
Positionierungsregelung
Implementierung einer Servo-Regelung zur exakten Positionierung des Stellgliedes. Studierende lernen, die Übertragungsfunktion zu berechnen und den Regler entsprechend zu parametrieren
Sprungantwort der Regelstrecke
Analyse der gesamten Regelstrecke einschließlich der Stelleinrichtung und des Dieselmotors. Die Sprungantwort wird aufgezeichnet, um den Übertragungsbeiwert der Regelstrecke zu ermitteln
Drehzahlregelung des Dieselmotors
Einsatz eines P-Reglers zur Drehzahlregelung des Dieselmotors. Die Studierenden optimieren den Regler und analysieren das Führungsverhalten des Regelkreises bei verschiedenen Motordrehzahlen und Belastungen
I-Regler zur Beseitigung der bleibenden Regeldifferenz
Einführung eines I-Reglers, um die bleibende Regeldifferenz im Regelkreis zu eliminieren. Dies erfordert eine periodische Berechnung des Eingangssignals des Stellgliedes über einen Timer-Interrupt
Erweiterte Programmierung
Ergänzung des Programms durch weitere Funktionen wie die stufenlose Vorgabe der Drehzahl und die erweiterte Ausgabe auf dem LCD, einschließlich der Motorparameter in realen Einheiten wie Umdrehungen pro Minute
Ein Blick ins Labor: Ausstattung und Arbeitsplätze
Ausstattung & Nutzung
Lehrveranstaltungen
- Digitale Regelungstechnik
Kontakt

Dipl. Ing. Bjarne Andresen
Nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter
Raum H332
Telefon 0461 805 1404
Fax 0461/805 - 1574