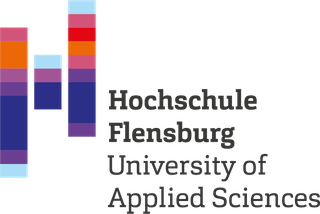Seit Juli verstärkt Prof. Dr. Manuela Schallenburger das Team des Fachbereichs Gesundheit und Pflege an der Hochschule Flensburg. Die Pflegewissenschaftlerin bringt langjährige Erfahrung aus der klinischen Praxis und der Forschung mit – und ein klares Ziel: Pflegekräfte wissenschaftlich zu stärken und ethische Fragen in der Intensivmedizin sichtbarer zu machen.

Seit Juli sind Sie Professorin an der Hochschule Flensburg. Was hat Sie an der Professur und am Standort besonders gereizt?
Ich muss dazu sagen, dass mir die ein oder andere Stellenausschreibung tatsächlich früher schon einmal untergekommen ist. Aber ich habe sie immer ignoriert, weil ich dachte: Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Job in Düsseldorf. Dann kam aber diese Stellenausschreibung, und zum einen hat mich Flensburg total gelockt. Ehrlicherweise, weil ich immer schon ein Nordkind war. Wir sind mit unserem Van sehr häufig hier oben im Urlaub, und für uns war immer klar: Irgendwann ziehen wir in den Norden – allerdings eher im Alter.
Und dann kam diese Stellenausschreibung, die einfach gepasst hat. Die Aufgaben, die Tätigkeiten, dass es vor allem um Lehre geht, um den Aufbau eines primärqualifizierenden Pflegestudiengangs – das hat sich sofort richtig angefühlt. Ich habe gedacht: Ich habe ja nichts zu verlieren, ich versuche es einfach mal. Dass es dann wirklich klappt, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und meistens klappt es ja gerade dann.
Wenn Sie heute auf Ihren beruflichen Weg schauen – von der Kinderkrankenpflege bis zur Professur – was war der entscheidende Impuls, Pflegewissenschaftlerin zu werden?
Der entscheidende Impuls kam, als ich aus privaten Gründen die Stelle gewechselt habe und an der Uniklinik Düsseldorf angefangen habe. Ich hatte mich dort als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin beworben und bekam das Angebot, die neu aufzubauende Palliativstation für Erwachsene mitzugestalten – auch, weil ich den Palliativ-Care-Kurs hatte. Dieses Angebot, eine Station mit aufzubauen, hat mich sehr gereizt. So etwas ist ja nichts Alltägliches für Pflegefachpersonen.
Und in dieser Aufbauphase, in der wir am Tisch saßen und überlegten, wie wir arbeiten möchten, habe ich gemerkt: Das macht mir Spaß, dieses Ausarbeiten, das tiefere Verständnis.
Als ich meine Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin gemacht habe, war der Beruf noch nicht akademisiert. Ich habe mich dann erkundigt, welche Wege es gibt, und bin auf den Studiengang Innovative Pflegepraxis gestoßen. Sozusagen die „kleine Pflegewissenschaft“, in der man vor allem den Theorie-Praxis-Transfer erlernt. Ich habe damals studiert, um zu studieren, weil mir die inhaltliche Arbeit so viel Freude gemacht hat, gar nicht mit einem festen Plan, was ich danach damit mache.
Im Bachelorstudium habe ich dann gemerkt: Das reicht mir nicht. Es war alles sehr oberflächlich, ich wollte tiefer einsteigen, vor allem in den Forschungsbereich. Denn die Pflege braucht wissenschaftliches Backup und man kann da wirklich etwas bewegen.
Ich habe anschließend den Master in Pflegewissenschaft auch in Witten/ Herdecke gemacht und hatte das große Glück, direkt in eine wissenschaftliche Stelle im Palliativzentrum in Düsseldorf einsteigen zu können. Rückblickend war also dieser Moment des gemeinsamen Planens und Entwickelns im Team der Auslöser für meinen Weg in die Pflegewissenschaft.
Kommen wir zu Ihrer preisgekrönten Studie, die ja auch Ihre Doktorarbeit war. Worum geht es dabei genau?
Ich habe meine Doktorarbeit nebenberuflich geschrieben, während ich in Düsseldorf in der Lehrkoordination gearbeitet habe. Das Thema war mir ein persönliches Anliegen, also habe ich es gemeinsam mit meinen Betreuern quasi als eigene kleine Forschungsgruppe entwickelt.
Es geht um Palliativpatientinnen und -patienten im Krankenhaus. Sie liegen nicht nur auf Palliativstationen – das wäre gar nicht machbar –, sondern werden oft auf anderen Stationen durch palliativmedizinische Dienste mitbetreut.
Auf Intensivstationen ist die Situation besonders komplex: Dort weiß man oft nicht, in welche Richtung sich der Zustand eines Menschen entwickelt. Intensivstationen sind auf Lebensrettung ausgelegt, aber dort liegen ebenfalls schwerkranke Menschen.
Deshalb rückt das Verständnis immer mehr dahin, dass Intensiv- und Palliativversorgung gar nicht so weit auseinanderliegen. Die Frage ist: Wie identifiziert man Patientinnen und Patienten, die von palliativer Versorgung profitieren würden? International arbeitet man an sogenannten „Triggerfaktoren“ – also Anzeichen, die darauf hinweisen könnten.
Im deutschsprachigen Raum war die Pflegeperspektive dabei bisher gar nicht untersucht worden. Dabei sind Pflegefachpersonen den Patientinnen und Patienten besonders nah, sie sehen Veränderungen oft früher und differenzierter. Daher war meine Idee, ihre Sichtweise zu erforschen.
Wie sind Sie methodisch vorgegangen?
Weil es zu dem Thema kaum Vorarbeiten gab, konnten wir keinen Fragebogen einfach übernehmen. Wir haben zunächst Fokusgruppen mit Pflegefachpersonen geführt: Was nehmen sie wahr? In welchen Situationen kommt das Palliativteam dazu? An welchen Stellen würden sie selbst das Team hinzuziehen – wenn sie dürften? Denn in Deutschland dürfen Pflegefachpersonen das offiziell (noch) nicht.
Diese Interviews haben wir qualitativ ausgewertet, daraus einen Fragebogen entwickelt und diesen dann noch einmal in größerer Breite eingesetzt. So konnten wir herausfinden, welche Triggerfaktoren Pflegefachpersonen tatsächlich sehen.
Die Jury hat ja auch den Mixed-Methods-Ansatz und die Praxisrelevanz hervorgehoben. Wie wichtig ist Ihnen diese Verbindung von Wissenschaft und Praxis?
Total wichtig. Ich habe in Witten gelernt: Forschung ist erst dann ethisch und moralisch vertretbar, wenn sie wieder in die Praxis zurückfließt – damit die Menschen, die vielleicht als Teilnehmende dabei waren, oder spätere Patientinnen und Patienten auch wirklich profitieren.
Das ist auch die Aufgabe unserer Bachelorstudierenden: Theorie in die Praxis zu bringen, damit sich die Versorgung und Pflegequalität verbessert.
Natürlich haben Pflegefachpersonen viel Erfahrungswissen aufgebaut, aber man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Forschung kann helfen, gute Lösungen zu identifizieren – und umgekehrt sollten die Forschungsfragen aus der Praxis entstehen. Dann passt beides wirklich zusammen.
Sie lehren im neuen Pflegestudiengang hier in Flensburg. Welche Schwerpunkte setzen Sie dort, und wie wollen Sie die Studierenden auf die Herausforderungen der modernen Pflege vorbereiten?
Die Schwerpunkte des Studiengangs sind die Versorgung älterer Menschen und die Digitalisierung in der Pflege. Durch den demografischen Wandel werden die Versorgungssituationen immer komplexer: Kaum jemand hat im Alter nur eine Erkrankung.
Wir müssen sicherstellen, dass alle Menschen – trotz Pflegenotstand – gut versorgt werden. Digitalisierung kann dabei helfen, wenn man sie verantwortungsvoll einsetzt.
Mir ist wichtig, dass unsere Studierenden ein Bewusstsein dafür entwickeln, was für einen wunderbaren, wenn auch herausfordernden Beruf sie erlernen. Sie sollen Selbstbewusstsein entwickeln und verstehen, dass Akademisierung keine Abgrenzung ist, sondern eine Ergänzung im Sinne eines Skills- und Grade-Mix, der die Pflege stärkt.
Was ist Ihnen bei der Ausbildung der Studierenden besonders wichtig, fachlich und menschlich?
Pflege ist ein Beruf am Menschen, und man sollte sich bewusst dafür entscheiden. Aber vor allem sollte man mit Herz und Leidenschaft herangehen. Ich finde es schwierig, Pflege nur als „Berufung“ zu sehen – das erzeugt zu viele Erwartungen. Aber wer empathisch ist, wer bereit ist, Perspektiven zu wechseln und sich auf andere Menschen einzulassen, der kann in der Pflege sehr viel geben – und auch sehr viel zurückbekommen.
Ich wünsche mir, dass die Studierenden in ihren Praxiseinsätzen erleben, wie wertvoll eine Begegnung auf Augenhöhe ist, auch wenn es immer eine gewisse Hierarchie gibt. Wir können von unseren Patientinnen und Patienten viel lernen – über Dankbarkeit, über Menschlichkeit.
Sie haben einmal gesagt: Pflege ist ein wissenschaftlich fundiertes Handlungsfeld. Wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen in der Akademisierung?
Zum einen braucht es einfach noch mehr Pflegeforschung, damit der wissenschaftliche Pool größer wird. Pflegewissenschaft ist eine junge Disziplin, die wachsen muss und dafür müssen Studiengänge erhalten bleiben. Leider werden aktuell manche Pflegewissenschaftsprogramme gestrichen.
Zudem müssen die Rollen akademisierter Pflegefachpersonen in der Praxis klar definiert werden. Es geht nicht darum, wer „besser“ oder „schlechter“ ist, sondern um eine gute Zusammenarbeit in interprofessionellen Teams. Dafür braucht es Aufklärung und gegenseitiges Verständnis.
Die Wahrnehmung der Pflege in der Gesellschaft ist ja oft noch nicht so positiv, wie sie sein sollte. Erleben Sie das auch so?
Ich hatte das Glück, immer in Bereichen zu arbeiten, wo Hierarchien flach sind – in der Pädiatrie und in der Palliativversorgung. Dort arbeitet man sehr interprofessionell, und eine gut ausgebildete Pflegefachperson wird als entscheidend für die Qualität der Versorgung angesehen.
Aber ja, gesellschaftlich höre ich natürlich auch Kommentare wie „Ach, du bist ja nur Krankenschwester“ oder „Warum studierst du Pflege?“. Dieses Denken hält sich leider noch. Gleichzeitig spüre ich, dass sich etwas verändert. Der Pflegenotstand ist in aller Munde, und viele Menschen erkennen inzwischen, wie anspruchsvoll dieser Beruf ist. Das steigert das Ansehen allmählich wieder.
Was wir noch stärker verankern müssen, ist das Verständnis für die Akademisierung. In Ländern, in denen Pflege längst akademisiert ist, hat das übrigens dazu geführt, dass wieder mehr Menschen diesen Beruf ergreifen.
Gerade für junge Menschen: Pflege ist ja auch körperlich und emotional herausfordernd. Kann das abschrecken?
Ich glaube, objektiv gesehen ja. Aber es sollte keine Hürde sein. Viele haben ein falsches Bild, geprägt von Medien oder Einzelfällen. Natürlich ist Pflege anstrengend, aber sie ist auch unglaublich erfüllend.
Es gibt immer mehr technische und organisatorische Hilfsmittel, und man arbeitet im Team – das trägt auch in schwierigen Momenten. Am besten ist es, sich das einfach anzuschauen: Wer Pflege einmal wirklich erlebt, merkt schnell, wie vielseitig und menschlich dieser Beruf ist.
Zum Schluss: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten – was wünschen Sie sich für die Zukunft der Pflege?
Ich wünsche mir, dass verstanden wird, dass Pflege ein akademischer Beruf sein kann und trotzdem ein praktischer bleibt. Bei Ärztinnen und Ärzten wird das ja auch nicht in Frage gestellt.
Ich wünsche mir mehr Offenheit und Verständnis für akademisierte Pflegefachpersonen – und dass dieses starke Teamgefühl in der Pflege erhalten bleibt und weiterwächst, auch in einem modernen, gemischten Qualifikationssystem.