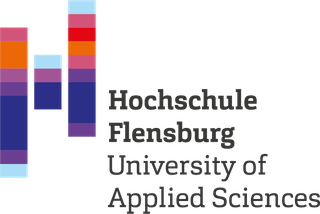Im Interview berichtet Volker Looks vom neuen Studiengang Gründung, Innovation und Entwicklung.

Im Studiengang Gründung, Innovation und Entwicklung starten Studierende bereits im ersten Semester ihr eigenes Unternehmen – mit echtem Geld, echten Kund*innen und echten Herausforderungen. Prof. Dr. Volker Looks, einer der Studiengangsleiter, erklärt im Interview, warum dieser Studiengang weit mehr ist als nur eine neue Variante der BWL – und warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, unternehmerisch zu denken und zu handeln.
Was macht den Studiengang Gründung, Innovation und Entwicklung so besonders – auch im Vergleich zu klassischen BWL- oder Ingenieurstudiengängen?
Es gibt eine ganze Reihe von Besonderheiten. Die erste und wohl auffälligste ist: Die Studierenden gründen tatsächlich ein eigenes Unternehmen – und das direkt im ersten Semester. Das Studium ist also extrem praxisorientiert. Man entwickelt Ideen, baut Prototypen, generiert Umsätze und verdient echtes Geld, das man dann wieder reinvestiert. Diese konsequente Praxisnähe unterscheidet uns deutlich von klassischen Studiengängen.
Eine zweite Besonderheit ist die hohe Wahlfreiheit. Klassische Studiengänge sind meist klar abgegrenzt – BWL, Ingenieurwesen oder Informatik. Wir hingegen vereinen all das und ermöglichen es den Studierenden ab dem dritten Semester, sich sehr individuell weiterzuentwickeln. Aus über 120 Modulen kann man sich ein persönliches Profil zusammenstellen, das zu den eigenen Stärken, Interessen und Projektanforderungen passt. Diese Freiheit ist in dieser Form außergewöhnlich.
Die Studierenden gründen also schon im ersten Semester ein Unternehmen. Wie gelingt dieser frühe Einstieg, und welche Unterstützung erhalten sie dabei?
Der gesamte Studiengang ist strukturell darauf ausgelegt, die Gründung im ersten Semester zu ermöglichen. Dazu stellen wir den rechtlichen Rahmen in Form eines sogenannten wirtschaftlichen Vereins bereit. So können die Studierenden vom ersten Tag an wirtschaftlich aktiv werden, ohne sich gleich durch die Formalitäten einer eigenen Gründung kämpfen zu müssen. Das ist gerade für junge Gründer*innen eine große Erleichterung.
Die Mittel, mit denen gearbeitet wird, kommen aus der Gemeinschaft, also aus dem wirtschaftlichen Verein. Das heißt auch: Entscheidungen über Investitionen werden gemeinsam getroffen. Das Risiko ist so kalkulierbar. Wir achten darauf, dass niemand überfordert oder in finanzielle Schwierigkeiten gebracht wird.
Wie funktioniert dann die Spezialisierung in den vier Profilen?
Die Profile ergeben sich aus den Modulen, die man zwischen dem dritten und fünften Semester wählt. Insgesamt sind es neun Spezialisierungsmodule, die man relativ frei aus dem Angebot der gesamten Hochschule zusammenstellen kann. Dabei gibt es gewisse Regeln, damit die Kombination fachlich sinnvoll bleibt.
Welches Profil man hat – ob Informatik und Gestaltung, Ingenieurwesen, Life Sciences oder BWL – ergibt sich daraus, wie hoch der jeweilige Anteil dieser Module ist. Wählt man beispielsweise sieben von neun Modulen im Bereich Ingenieurwissenschaften, ist man im Ingenieursprofil. Man wählt also kein fertiges Profil, sondern gestaltet sich seinen Weg selbst, je nach Interesse, Begabung und natürlich auch den Anforderungen des eigenen Gründungsprojekts. Doppelt?
Wie wirkt sich das auf die Rolle im Gründungsteam aus? Wird man dann automatisch der „Techniker“ oder „Informatiker“ im Team?
Das hängt stark von der Persönlichkeit ab. Wer tief in die Technik oder Informatik eintaucht, wird im Team wahrscheinlich diese Rolle übernehmen. Andere wollen vielleicht eher führen oder organisieren und wählen dann Module, die stärker in Richtung Management, Kommunikation oder Prozessgestaltung gehen. Das Schöne ist: Man hat die Freiheit, das Studium genau auf diese Rolle hin auszurichten – je nachdem, wie man sich selbst sieht und wohin man sich entwickeln möchte.
Welche beruflichen Perspektiven haben Absolvent*innen? Ist die Gründung das einzige Ziel?
Nein, keineswegs. Viele kommen mit dem Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und es ist natürlich großartig, wenn das gelingt. Andere wollen erstmal Berufserfahrung sammeln und später gründen. Wieder andere nutzen das Studium, um sich fachlich stark aufzustellen und dann in klassische Berufsfelder zu gehen.
Wer beispielsweise den Informatikschwerpunkt wählt, kann bis zu 70 Prozent des Studiums mit Informatikmodulen belegen – das reicht locker, um danach einen Master in Informatik zu machen oder als Informatiker*in ins Berufsleben einzusteigen. Genauso im Bereich Technik oder Wirtschaft. Der große Unterschied zu anderen Studiengängen ist: Unsere Absolvent*innen haben nicht nur Prüfungen geschrieben, sondern echte und vor allem eigene Projekte umgesetzt. Das bringt eine ganz andere Umsetzungsstärke mit sich. Das macht sie auf dem Arbeitsmarkt sehr attraktiv.
Inwiefern unterscheidet sich das Lernen und Arbeiten im Studiengang von herkömmlichen Studienformaten?
Klassisch läuft es so: Vorlesung, Übung, Labor, Klausur, vor allem in den ersten Semestern. Bei uns steht vom ersten Tag an das eigene Gründungsprojekt im Mittelpunkt. Die klassischen Formate wie Vorlesungen und Übungen sind darauf ausgerichtet, das Projekt zu unterstützen.
Der Anteil an formalen Lehrveranstaltungen liegt bei uns vielleicht bei 40 Prozent. Der Rest ist selbstgestaltete Projektarbeit. Die Studierenden müssen in Teams arbeiten, mit Kunden sprechen, Entscheidungen treffen – es braucht ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Und genau das motiviert viele. Sie wissen: Sie arbeiten nicht für die Note, sondern an etwas Echtem, das ihnen gehört.
Die Studierenden entwickeln also nicht nur fachliche, sondern auch persönliche Kompetenzen. Was nehmen sie fürs Leben mit?
Sehr viel. Ein Beispiel: Bis Ende des ersten Semesters sollen die Studierenden Kund*innen gefunden und ihnen etwas verkauft haben. Das heißt: Leute ansprechen, sich trauen, sich mit Ablehnung auseinandersetzen. Die meisten machen das sonst erst im Berufsleben – bei uns passiert das gleich zu Beginn des Studiums.
Es geht aber nicht nur um Kundenkontakt. Es gibt Konflikte im Team, Finanzierungsgespräche im Verein, technische Herausforderungen – alles, was echte Unternehmer*innen auch erleben. Aber sie sind dabei nicht allein: Wir haben zwei professionelle Coaches, rund 20 Professor*innen und wissenschaftliche Mitarbeitende, die sie begleiten. Und natürlich ihre Kommiliton*innen. Diese Mischung aus Herausforderung und Unterstützung fördert nicht nur Fach-, sondern vor allem Selbstkompetenz, Resilienz und Teamfähigkeit.
Warum ist dieser Studiengang gerade jetzt – in Zeiten von Transformation, Digitalisierung und Klimakrise – besonders relevant?
Weil wir Macher*innen brauchen. Die Welt verändert sich rasant, und wir sehen, dass es oft nicht schnell genug geht. Viele erklären, warum Dinge nicht funktionieren – Verwaltung, Regularien, Zuständigkeiten. Wir wollen Menschen ausbilden, die nicht lange warten, sondern handeln. Die sagen: Ich probiere es einfach! Wir brauchen diese Haltung jetzt mehr denn je.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Auch für Sie als Professor verändert sich mit diesem Studiengang vieles. Wie empfinden Sie diesen Wandel?
Natürlich ist es ein Sprung. Früher habe ich klassische Vorlesungen gehalten, mit vielen Folien, genauem Ablauf, klarer Prüfungsstruktur. Aber ich habe schnell gemerkt, dass das nicht wirklich funktioniert. In den letzten Jahren habe ich schon zunehmend projektbasiert gearbeitet – zum Beispiel mit Maschinenbau- und BWL-Studierenden, die eine virtuelle Fabrik redesignen. Das war schon näher an dem, was wir jetzt machen.
Ganz neu ist also nicht alles – viele der Bausteine kennen wir aus anderen Kontexten. Und durch unser Gründungsprogramm „TestUp“ haben wir schon viele technische Gründungen begleitet. Trotzdem ist es spannend, weil wir nie wissen, was kommt. Was bringen die nächsten 30 Studierenden mit? Welche Ideen, welche Herausforderungen?
Das ist manchmal auch scary, weil der Inhalt des Studiums stark von den Projekten der Studierenden geprägt ist. Aber genau das ist auch das Schöne: Wir kehren zurück zu unseren Wurzeln – dahin, wo man nie weiß, welches Problem als Nächstes kommt. Wie in der realen Wirtschaft. Und das macht einfach große Freude.